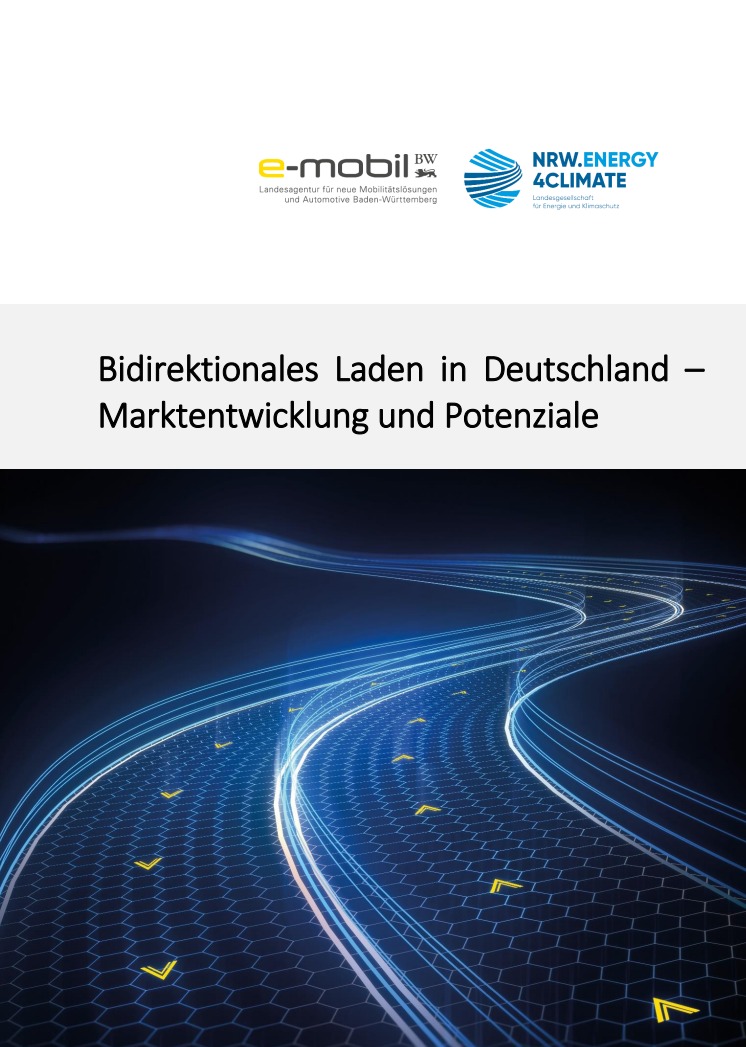E-Lkw und -Busse können entweder über Nacht mit Wechselspannungsladung (bis zu 22 Kilowatt) oder per Gleichspannungsladung (größer gleich 50 Kilowatt) im Tagesverlauf auf dem Betriebsgelände geladen werden (konduktives statisches Laden, per Stecker oder Pantograph). Für weitere Strecken und bei einem Fahrprofil, bei dem der Lkw nicht abends zum Depot zurückkehrt, wird ein öffentliches Ladeinfrastrukturnetz entlang der Fernstraßen notwendig. Hierzu wurde das durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) finanzierte Projekt HOLA (Hochleistungsladen für LKW an der Bundesautobahn A2) im August 2021 gestartet.
In dem Projekt soll die MCS-Technologie implementiert werden. MCS steht für Megawatt Charging System. Der seit 2018 in der Entwicklung befindliche Ladestecker wird für das Laden mit bis zu 4,5 Megawatt (3.000 Ampere bei 1.250 Volt) Gleichstrom (DC) ausgelegt. Bei Schnellladung spricht man von Ladeleistungen über 50 kW bis hin zu aktuell 350 kW. Für Pkws, die die entsprechende Ladetechnik an Bord haben, können 100 Kilometer Reichweite in nur wenigen Minuten nachgeladen werden. Damit ließen sich zwar auch Batterien von Nutzfahrzeugen befüllen, aber die Ladezeiten wären zu lang. Bei einer durchschnittlichen Ladeleistung von 300 kW kann in etwa einer Stunde 50 Prozent des Energiegehalts der Batterie wieder aufgeladen werden.
Beim Megawattladen verkürzt sich die Zeit circa um den Faktor drei. Auch im ÖPNV werden Schnelllader an Endhaltestellen eingesetzt. Dies geschieht häufig über einen Pantographen, um Busse mit kleinen Batterien wiederholt im Laufe des Tages nachladen zu können (Gelegenheitsladen).