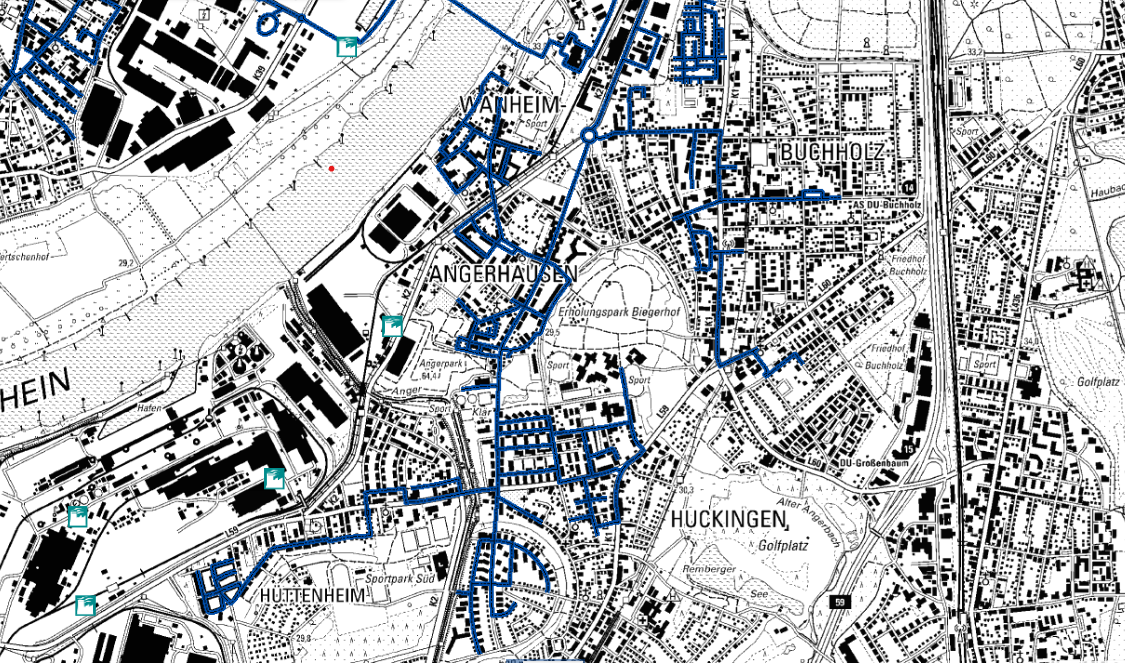Das Industrieland NRW hat ein enormes Potenzial an industrieller Abwärme, was eine wertvolle, effiziente und klimafreundliche Quelle für die allgemeine Wärmeversorgung darstellt. Für eine gelungene Wärmewende in NRW gilt es, diese Potenziale vermehrt zu erschließen.
Das Wärmeplanungsgesetz §3 Nr.13 gibt eine bundesweit einheitliche Definition zu unvermeidbarer Abwärme vor:
„„unvermeidbare Abwärme“ Wärme, die als unvermeidbares Nebenprodukt in einer Industrieanlage, Stromerzeugungsanlage oder im tertiären Sektor anfällt und ohne den Zugang zu einem Wärmenetz ungenutzt in die Luft oder in das Wasser abgeleitet werden würde; Abwärme gilt als unvermeidbar, soweit sie aus wirtschaftlichen, sicherheitstechnischen oder sonstigen Gründen im Produktionsprozess nicht nutzbar ist und nicht mit vertretbarem Aufwand verringert werden kann.“
Im Nordrhein-Westfalen sind vielfältige Produktionsbetriebe ansässig und somit fällt an zahlreichen Standorten Abwärme an. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) hat 2019 eine Studie veröffentlicht, aus der ein technisch verfügbares Potenzial von industrieller Abwärme in NRW von bis zu 96 Terawattstunden (TWh) hervorgeht. Zum Vergleich: Der Fernwärmebedarf in NRW lag zur selben Zeit bei 30 TWh pro Jahr, wurde allerdings zu zirka 80 Prozent aus fossilen Brennstoffen und kaum über Abwärme gedeckt. Rein rechnerisch überstieg somit das Abwärmepotenzial bereits den Fernwärmebedarf um mehr als das Dreifache, weswegen es zukünftig stärker ausgeschöpft werden soll. Durch den zusätzlichen Ausbau von Wärmenetzen kann es außerdem gelingen, sogar noch mehr Abwärme zu erschließen und zu den Verbrauchern zu transportieren.
Nutzungsmöglichkeiten von industrieller Abwärme
Industrielle Produktionsprozesse sind häufig sehr energie- und vor allem wärmeintensiv. Oberste Priorität für Unternehmen hat dabei die Verringerung des eigenen Prozesswärmebedarfs, etwa durch Prozessoptimierungen und Nutzung von Einsparpotenzialen. Weiterhin anfallende „unvermeidbare“ Abwärme kann häufig sinnvoll betriebsintern genutzt werden, z. B. zur Brennluftvorwärmung oder für Trocknungsprozesse, Hallenheizung und Warmwassererzeugung. In vielen Fällen fällt mehr Abwärme an, als auf dem Betriebsgelände genutzt werden kann, sodass durch eine Einspeisung ins Wärmenetz auch benachbarte Unternehmen, Stadtquartiere und Gebäude mit Wärme versorgt werden können. Das Energieeffizienzgesetz verpflichtet Unternehmen zur Vermeidung von Abwärme. Unvermeidbare Abwärme muss selbst genutzt oder zur externen Nutzung zur Verfügung gestellt werden (§ 16), wobei Daten zur anfallenden Abwärme an die Bundesstelle für Energieeffizienz zu melden sind (§ 17).
Wärmenetze ermöglichen es, die Wärme aus verschiedenen klimafreundlichen Quellen in Gebäude oder zu weiteren Industrieprozessen zu befördern, weswegen ihre Bedeutung in der Wärmeversorgung der Zukunft zunehmen wird. Bestehende Fernwärmesysteme basieren zu einem Großteil auf Wärme aus Kohle- oder Gasverbrennung, müssen jedoch bis spätestens 2045 durch klimaneutrale Wärmequellen ausgetauscht werden.Nach Wärmeplanungsgesetz §29 müssen ab 2030 min. 30 Prozent und ab 2040 min. 80 Prozent der Wärme im Wärmenetz aus Erneuerbaren Energien und/oder unvermeidbarer Abwärme stammen. Industrielle Abwärme bietet in NRW ein enormes Potenzial, die Fernwärme klimaneutral bereitzustellen. Im Rahmen einer interdisziplinären Arbeitsgruppe wurde ein Leitfaden zur Erschließung von Abwärmequellen für die Fernwärmeversorgung über den Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V. (AGFW) erarbeitet. Zum Leitfaden gelangen Sie hier.
Zukünftige Entwicklung von Abwärme
Bis 2045 stehen in der Prozesswärme weitreichende Umstellungen auf klimaneutrale Erzeugung an. Dadurch, und durch weitere energetische Optimierung von Prozessen, werden sich Abwärmepotenziale verändern. Effizienzsteigerungen in der Produktion führen genauso zu geringerer Abwärme wie ein Energieträgerwechsel, beispielsweise durch die Elektrifizierung von heute brennstoffbasierten Anlagen. Gleichzeitig werden zunehmend neue Abwärmequellen für Wärmenetze und Quartiere entstehen, wobei insbesondere Elektrolyseure im Zusammenhang mit dem Aufbau der viel diskutierten zukünftigen Wasserstoffwirtschaft eine Rolle spielen werden (Grafik zu Farben des Wasserstoffs).
Bei der Planung eines Abwärmeprojektes sollten Industrieunternehmen und Wärmenetzbetreiber vor diesem Hintergrund frühzeitig prüfen, ob der Prozess, aus dem Abwärme ausgekoppelt werden soll, diese Wärme auch langfristig zur Verfügung stellen kann.
Die Fortschreibung der Abwärmepotenziale bis 2045 wird in diesem Jahr durch eine neue Wärmestudie des LANUV untersucht. Sobald Ergebnisse veröffentlicht sind, finden Sie sie an dieser Stelle.